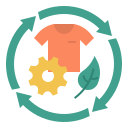This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
Die moderne Textilindustrie steht heute mehr denn je vor der Herausforderung, neue Wege im Sinne der Nachhaltigkeit zu gehen. Nachhaltige Textiltechnologien spielen hierbei eine entscheidende Rolle, da sie umweltfreundliche Alternativen zu traditionellen Herstellungsprozessen bieten und dadurch Ressourcen, Energie und Emissionen sparen. In diesem Beitrag werden verschiedenste Aspekte dieser zukunftsweisenden Technologien beleuchtet – von innovativen Fasermaterialien über umweltschonende Färbeverfahren bis zu Kreislaufwirtschafts-Konzepten und digitaler Produktion. Der Fokus liegt dabei auf den zahlreichen Chancen, die sich sowohl für Hersteller als auch Konsumenten ergeben. Gleichzeitig werden auch Lösungsansätze präsentiert, wie ökologische, soziale und ökonomische Herausforderungen mithilfe nachhaltiger Technologien gemeistert werden können.
Innovative Fasermaterialien
Umweltfreundliche Färbe- und Veredelungsverfahren
Wasserlose Färbesysteme
Einsatz pflanzlicher Farbstoffe
Energiesparende Veredelungsverfahren

Digitalisierung und Industrie 4.0
Automatisierte Produktionssysteme